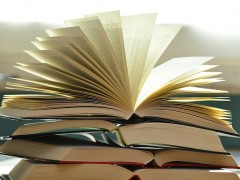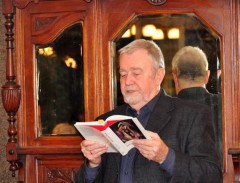Vortrag und Lesung von Michael Markel in Nürnberg
Was der Nürnberger Kulturbeirat zugewanderter Deutscher in Zusammenarbeit mit dem Bildungscampus der Stadtbibliothek Nürnberg am 24.1.2014 im Zeitungs-Café Hermann Kesten veranstaltet hat, war äußerst sehenswert oder besser hörenswert: Anhand der Texte von elf Autoren aus Siebenbürgen und dem Banat zeigte Michael Markel, wie vielfältig das Kollektivtrauma der Deportation literarisch verarbeitet wurde. Das Urteil hier: lesenswert!
Einleitend umriss Markel zunächst einmal die Deportation als historisches Geschehen: Noch vor Ende des Krieges wurden etwa 360.000 arbeitsfähige Deutsche aus Mittel- und Osteuropa zur „Aufbauarbeit“ in die Sowjetunion geschickt. Neben Jugoslawien (73.000) und Ungarn (50.000) hatte v. a. Rumänien mit seinen 70.000 Deportierten ein großes Kontingent zu stellen, welches sich aus etwa 30-35.000 Banater Schwaben, 30.336 Siebenbürger Sachsen, 5.324 Sathmarschwaben und Nordwestsiebenbürgern und 5.000 Deutschen aus dem Altreich zusammensetze. Sie wurden mehrheitlich in Arbeitslager im Donbass (Donezbecken) geschickt, wo sie im Bergbau, der Schwerindustrie und auf Baustellen arbeiten mussten. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen waren freilich miserabel, sodass etwa 15% der Deportierten starben, bis 1949 die Rückführung beschlossen wurde. Der letzte Siebenbürger kehrte erst 1956 nach Hause. Für die Banater endete ungefähr zur selben Zeit ein weiteres Kapitel der Deportation, und zwar die Zwangsverschleppung von 40.000 Banatern (darunter ein Viertel Deutsche) in den Bărăgan. 1951 waren es v. a. die dörflichen Eliten, die aus politischem Kalkül in die Steppe südöstlich von Bukarest deportiert wurden, bevor man sie 1955 wieder entließ.
Zu dieser Zeit der Verschleppung und Zwangsarbeit ist sowohl Gelegenheitsliteratur – also Gedichte und Lieder, die im Lager selbst entstanden sind – als auch Erinnerungsliteratur erhalten, die Erfahrenes in Sprache fasst, mitteilbar macht und für die Nachwelt in Gedenken umwandelt. Wenn nun aber die Fakten bekannt und die Klagelieder gehört sind, welche Legitimation hat da noch die schöne Literatur? Markel zieht einen Vergleich mit der Meteorologie: Temperaturen und Niederschlagsmengen kann man messen und die Zahlen für verschiedene Tätigkeiten praktisch nutzbar machen. Doch um wirklich nachzuvollziehen, wie sich die Kälte oder Stunden des Hungers anfühlen, braucht man Worte. Worte, die das Herz berühren.
Wenn auch die meisten literarischen Werke über die Deportation wegen der Zensur erst mit einigen Jahrzehnten Verspätung geschrieben oder herausgebracht werde konnten, gibt es doch ein paar Romane und Dramen, die schon die Zeitgenossen kannten: Das Christi-Geburt-Spiel der Siebenbürger Sachsen im Donbas (1947) von Georg Brenndörfer (*1906 als Felix Gebauer in Kronstadt), das bereits 1947 erstmals in einem Massenschlafraum des Lagers Almasna uraufgeführt wurde, thematisiert vor allem die Not, also Hunger und Frost, sowie die Erlösungsverheißung des Engels, an die anfangs kein Lagerhäftling im Stück wirklich glauben will. In eine etwas andere Richtung zielt Rainer Biemels (*1910 in Kronstadt) Mein Freund Wassja, das 1949 unter dem Pseudonym Jean Rounault auf Französisch herausgegeben wurde und nach großem Erfolg in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Mit der Darstellung der erlebten Lagerrealitäten ließ sich damals nicht nur gut Politik gegen die französische KP, die Sowjetunion und die Doppelmoral des Kommunismus machen. Biemel zeichnet auch die tiefsten Abgründe menschlicher Existenz nach, wenn er zum Beispiel das allmähliche Vertrautwerden mit dem Tod beschreibt. Als ein regelrechter Abenteuerroman stellt sich hingegen die Erzählung der Deportation (und der geglückten Flucht) beim Hermannstädter Bernhard Ohsam (*1926) dar, der 1958 in Eine Handvoll Machorka (1995 bearbeitet und erweitert unter dem Titel Hunger & Sichel herausgegeben) die Bedeutung des Lachens für die Bewältigung der Situation hervorhebt.
Der Banater Johann Lippet (*1951) konnte seinen Gedichtband biographie. ein muster 1980 erstaunlicherweise unter Zensur veröffentlichen, obwohl er darin die Russland- und Bărăgandeportation offen thematisierte. Dasselbe gilt für den Banater Horst Samson (*1955), der ab 1978 Gedichtbände veröffentlichte, in denen er auch die Deportation verdeckt aufgriff. Neben der Camouflage war der Gebrauch der Mundart eine weitere Möglichkeit, an der Zensur „vorbeizuschreiben“, denn sie wurde als beschränkt im Ausdruck und daher als nicht gefährlich angesehen. Sowohl Hans Kehrer (*1913 als Stefan Heinz) als auch Ludwig Schwarz (*1925) bedienten sich in ihren Werken der schwäbischen Mundart und fanden so eine Nische, um über die Deportation zu reden; erster in seinem Drama Zwei Schwestern (1980), letzter im unvollendeten, mehrbändigen Roman De Kaule-Baschtl (1977-1981). Wie ausdrucksstark die schwäbische Mundart tatsächlich ist, zeigte Inge Liess, die zwei Passagen aus De Kaule-Baschtl vortrug.
Anders erging es Erwin Wittstock (*1899), dessen Manuskript zu Januar ’45 oder die höhere Pflicht in den 1950ern von der Zensur konfisziert und erst 1991 als Fortsetzungsroman im „Neuen Weg“ erscheinen konnte. Wenn Wittstock auch ein guter Erzähler ist, so wird sich doch manch ein Leser weigern, die ideologische Überhöhung der Deportation als Volksschicksal, als „höhere Pflicht des redlichen Beisammenstehens“ anzuerkennen. Erwin Wittstocks Sohn Joachim (*1939 in Hermannstadt) hingegen thematisiert 2003 in Bestätigt und besiegelt mit Blick auf die Abwesenheit der Betroffenen die Deportation viel mehr als Leiderfahrung und Kollektivbuße für schuldhafte Verstrickungen in den Kriegsjahren. Ebenfalls die Geschichte eines anderen erzählt der Banater Richard Wagner (*1952 in Lowrin), der 2004 in Habseligkeiten die Deportation seines Vaters behandelt. Neben den bekannten Problemen Hunger, Hygiene, Kälte und Sterben bekommt die Deportation bei Wagner eine neue Dimension, und zwar die des allgemein osteuropäischen Problems. Die Problematik wiederum des Nicht-selbst-Zeuge-Seins wurde an keiner Stelle so prominent diskutiert wie bei Herta Müller (*1953 Nitzkydorf). Muss ein Autor eine Situation selbst erfahren haben, um darüber schreiben zu dürfen? Oder zeigt nicht gerade Müllers Atemschaukel von 2009, dass das eingehende Gespräch mit Betroffenen ausreichend sein kann, um ebenso einfühlsam wie eindringlich deren Erinnerungen wiederzugeben, wenn man nur die richtigen sprachlichen Mittel zu benutzen weiß?
Letztlich ist es doch das, was die Autoren leisten: Wie bringt man dem Leser die immergleiche und aus der Erinnerungsliteratur unter Umständen längst bekannte Lagerwirklichkeit näher, ohne ihn zu langweilen? Aus der Perspektive der Zurückgebliebenen kommt die Ratlosigkeit zum Ausdruck, aus der jugendlichen Erzählweise blitzt das Abenteuerhafte hervor, hier wird die Not der Häftlinge greifbar und dort wird das Geschehen politisch interpretiert, der eine gestaltet das Thema humorvoll, der andere künstlerisch aus… Die letzten Zweifel bezüglich der Legitimation der schönen Literatur zu diesem Thema sollte Michael Markel mit seinen Ausführungen über die erstaunliche Vielfalt der literarischen Ausgestaltung in jedem Fall ausgeräumt haben.
Dagmar Seck